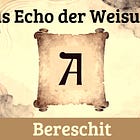Die verdrängten Erstgeborenen
Das 1. Buch Mose: Nicht der Erstgeborene erbt den Segen, sondern der Erwählte. Ein Handeln Gottes, das bis ins Neue Testament ausgreift – und dort soziale Sprengkraft entfaltet.
Im „Echo der Weisung“ zum Wochenabschnitt Bereschit („Im Anfang“) habe ich über Toldot („Hervorbringungen“) als ein strukturierendes Grundwort im 1. Buch Mose geschrieben.
Der sechste Wochenabschnitt in 1. Mose 25,19–28,9 heißt nun selbst Toldot. In ihm geht es um die „Hervorbringungen“ bzw. „Nachkommen“ von Jizchak, geboren von seiner Frau Riwka. Die Pa…