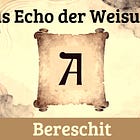Herausgerufen: Abrahams Erbe und Jesu Nachfolge
Der Wochenabschnitt Lech Lecha verbindet Abraham und Jesus. Beide folgten einem radikalen Ruf, der den Bruch mit der Vergangenheit bedeutete, um am Ende eine große Nachkommenschaft zu finden.
Das Neue Testament versteht man am besten als „neu“, wenn man es als Echo, als Widerhall und Resonanz der Tora wahrnimmt. Es klingt nicht aus sich selbst heraus.
In 1. Mose 11,27 beginnen die Toldot, die Hervorbringungen (Entwicklungen, Erzeugnisse) Terachs. Siehe dazu:
Neben Nahor und Haran (über den nur gesagt wird, dass er stirbt; siehe dazu Walter Ro…