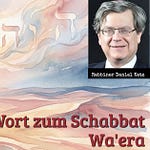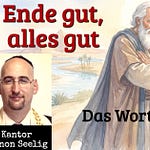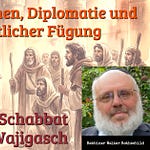Kantor Amnon Seelig erklärt den Wochenabschnitt „Pinchas“ aus dem 4. Buch Mose, 25,10–30,1 und konzentriert sich dabei auf zwei zentrale Aspekte dieser langen Parascha.
Bei ahavta - Begegnungen kannst du den Tora-Abschnitt der Woche in der Übersetzung durch Rabbiner Simon Bernfeld lesen oder sogar als Podcast anhören:
Die Geschichte von Pinchas
Seelig interpretiert Pinchas’ Gewalttat als Ausnahme, die die Regel bestätigt. Pinchas hatte einen Israeliten und eine Midianiterin durchbohrt und erhält dafür von Gott den „Bund des Friedens“. Der Kantor betont, dass normalerweise niemand das Gesetz in die eigene Hand nehmen darf – das Judentum ist eine Religion des Gesetzes, nicht der Willkür. Gott billigte Pinchas’ Handeln ausnahmsweise und wollte verhindern, dass er dafür bestraft wird. Seelig bezeichnet Pinchas als den letzten Menschen in der Tanach-Geschichte, der gegen das Gesetz handelte und trotzdem göttliche Billigung erhielt.
Die Töchter Zelophchads - Vorkämpferinnen für Frauenrechte
Der Hauptfokus liegt auf den fünf Töchtern Zelophchads: Machla, Noa, Chogla, Milka und Tirza. Ihr Vater stirbt ohne männliche Erben in der Wüste, und sie fordern vor Mose ihr Erbrecht ein. Sie argumentieren: „Warum soll nun ausgehen der Name unseres Vaters aus seinem Geschlechte, weil er keinen Sohn hat, gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters“.
Moses wendet sich ratlos an Gott, der den Töchtern Recht gibt – sie dürfen erben, müssen aber innerhalb ihres Stammes heiraten, damit die Landverteilung stabil bleibt. Seelig bezeichnet dieses Gesetz als revolutionär für die Zeit vor 3500 Jahren, da Frauen normalerweise zur Familie ihres Mannes gehörten und dessen Namen annahmen.
Rabbinische Würdigung und symbolische Bedeutung
Die Rabbiner durch die Generationen schwärmen von den Töchtern Zelophchads und preisen sie als weise, klug und tüchtig. Im Gegensatz zu anderen Israeliten, die Ägypten vermissen und das Heilige Land fürchten, fordern diese Frauen aktiv ihr Erbe im Land ein. Seelig sieht sie als „fantastisches Gegenbeispiel zu der Feigheit des Restes des Volkes“.
Besonders bemerkenswert findet der Kantor die symbolische Bedeutung ihrer Namen, die alle mit Bewegung und Fortschritt verbunden sind:
Machla: sich kreisen, umdrehen, tanzen
Noa: sich bewegen
Chogla: umdrehen
Milka: laufen, gehen
Tirza: (impliziert ebenfalls Bewegung)
Diese Namen symbolisieren, wie die Frauen „das Volk und den Stand der Frau vorangebracht“ haben. Seelig empfiehlt diese Namen als Vorbilder für Töchter. Ich habe daraufhin die fünf Frauen scherzhaft als „die ersten Zionistinnen“ bezeichnet, da sie unbedingt ins Heilige Land wollten.