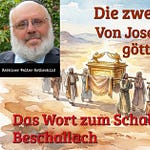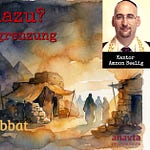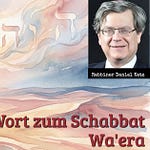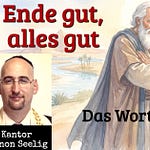Im „Wort zum Schabbat“ vom 21. November 2025 spricht Rabbiner Andrew Steiman über den Tora-Abschnitt Toldot (Die Geschlechter/Hervorbringungen) in 1. Mose 25,19 bis 28,9.
Das Gespräch beginnt mit einer zeitlichen Einordnung: Der neue jüdische Monat Kislew hat begonnen, was den Rabbiner dazu veranlasst, auf das kommende Lichterfest Chanukka hinzuweisen. Er zieht Parallelen zum christlichen Kalender, der sich nach dem Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag der Adventszeit nähert. Steiman betont dabei die Gemeinsamkeiten im Gedenken, etwa die jüdische Bezeichnung des Friedhofs als „Haus des Lebens“.
Im Zentrum der Betrachtung steht die biblische Erzählung der Zwillingsbrüder Jakob und Esau. Steiman beleuchtet die tiefen Konflikte, die bereits im Mutterleib beginnen. Er analysiert die berühmte Szene des Verkaufs des Erstgeburtsrechts für ein Linsengericht. Dabei verweist er auf eine moderne hebräische Redewendung: Wenn man in Israel sagt, man habe etwas „für ein rotes Linsengericht“ erworben, schwingt mit, dass jemand „über den Tisch gezogen“ wurde, der Wert für die Zukunft aber dennoch beträchtlich sein kann.
Ein wichtiger Fokus liegt auf der Rolle der Mutter Riwka (Rebekka). Sie greift aktiv in die Erbfolge ein, da sie spürt, welcher Sohn die Tradition in die Zukunft tragen kann. Steiman hebt hervor, dass biblische Helden in der Tora nicht idealisiert, sondern mit all ihren menschlichen Schwächen gezeigt werden – so auch der fast blinde Vater Isaak, der sich täuschen lässt.
Das Gespräch weitet sich auf philosophische und aktuelle gesellschaftliche Fragen aus. Unter Berufung auf den ehemaligen britischen Oberrabbiner Jonathan Sacks unterscheidet Steiman scharf zwischen Optimismus und Hoffnung („Hatikwa“). Optimismus sei eine passive Haltung, Hoffnung hingegen etwas Aktives, das man sich „machen“ müsse. In Bezug auf das Gedenken an den 9. November warnt er vor einer Vereinnahmung der Geschichte durch „laute Stimmen“ und betont, dass das Erinnern an die Vergangenheit stets der Gestaltung der Zukunft dienen müsse.
Steiman erläutert den Namen „Israel“ als „Gotteskämpfer“. Ein Jude könne an Gott zweifeln oder verzweifeln, ihn aber niemals ignorieren – eine Referenz an Elie Wiesel. Auch der Begriff „Jude“ (von Jehuda) wird etymologisch als „der Dankbare“ hergeleitet.
Gegen Ende des Gesprächs schlägt der Rabbiner den Bogen zurück zu Chanukka. Er erklärt, dass ohne den erfolgreichen Aufstand der Makkabäer das Judentum untergegangen wäre und das Christentum gar nicht erst hätte entstehen können. Sprachlich verbindet er Chanukka mit Chinuch (Bildung/Erziehung). „Bildung im Quadrat ist Weihe“, resümiert er. Das Gespräch schließt mit dem Wunsch nach „Schalom“ – nicht nur als Frieden, sondern im Sinne von „Schalem“, einer Ganzheit und Vollständigkeit, die erst durch Versöhnung und gegenseitiges Lernen erreicht wird.
Danke an Mechthild Wallbrecher, Micha L. und viele andere, die sich das Live-Video angeschaut haben! Schaut auch beim nächsten Wort zum Schabbat live in der App herein!