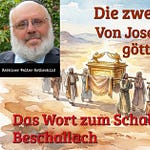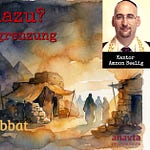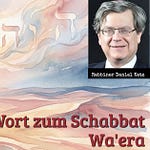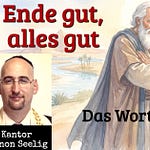Rabbiner Dr. Walter Rothschild spricht in seiner Auslegung zum Wochenabschnitt Schemini, 3. Buch Mose, Kapitel 9-11, über mehrere miteinander verflochtene Themen, die sowohl den biblischen Text als auch aktuelle Ereignisse berühren.
Der biblische Text und seine Bedeutung
Rothschild erläutert, dass der Wochenabschnitt von einer Tragödie berichtet: Zwei der fünf Priester, die Söhne Aarons namens Nadav und Abihu, kommen durch Feuer ums Leben, als sie ein „fremdes Feuer“ (Esch Sara) darbringen, das nicht von Gott befohlen war. Er interpretiert dies nicht als göttliche Strafe, sondern eher als tragischen Unfall – vergleichbar mit einem Betriebsunfall. Die jungen Priester sind erst seit einer Woche im Amt, haben wenig praktische Erfahrung und sind möglicherweise unvorsichtig mit dem heiligen Feuer umgegangen.
Besonders bewegend ist Rothschilds Interpretation der Reaktion Aarons auf den Tod seiner Söhne: "Und Aaron schwieg" (Vajidom Aharon). Dieses Schweigen deutet Rothschild als Schockzustand und tiefe Trauer. Erst später bricht Aaron sein Schweigen in einer Art Verzweiflung, als Mose ihm befiehlt, weiter seinen priesterlichen Pflichten nachzugehen und vom Opferfleisch zu essen.
Verbindung zur Gegenwart
Rothschild verknüpft den biblischen Text mit aktuellen Ereignissen, insbesondere mit Jom HaSchoa, dem israelischen Holocaust-Gedenktag. Er reflektiert über die Bedeutung des Gedenkens 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, während die letzten Zeitzeugen sterben. Er fragt sich, wie die Erinnerung weiterleben wird, wenn keine direkten Zeugen mehr da sind.
Er zieht Parallelen zwischen dem Verlust der Söhne Aarons und dem Verlust von Millionen im Holocaust, wobei er besonders die Tragödie der Massenkrematuren hervorhebt – für viele Juden fast so schlimm wie der Massenmord selbst, weil es bedeutet, kein Grab zu haben, das man besuchen kann.
Feuer als Symbol
Rothschild stellt eine Verbindung her zwischen dem heiligen Feuer im biblischen Text und religiösen Feuerpraktiken in anderen Traditionen. Er berichtet von den problematischen „heiligen Feuern“ der orthodoxen Osterfeierlichkeiten im Jerusalem des 19. Jahrhunderts, basierend auf Berichten deutscher Templer. Diese Beschreibung dient ihm als Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Religion ihre wahren Werte verliert und zu Aberglauben wird.
Speisegesetze
Zum Schluss geht Rothschild kurz auf die Speisegesetze in Kapitel 11 ein. Er reflektiert über die Besonderheit des Menschen, der – im Gegensatz zu anderen Raubtieren – sein Fleisch nicht lebendig frisst, sondern es nach bestimmten Regeln schlachtet und zubereitet. Die Speisegesetze sieht er als Teil eines ethischen Systems, das den Menschen von der Natur unterscheidet.
Rothschild schließt mit Gedanken zur Erinnerungskultur und zur Frage, wie lange die besondere Sensibilität gegenüber dem Holocaust anhalten wird, bevor er – wie andere historische Ereignisse – in die Geschichtsbücher übergeht.
Die Tora-Auslegung des Rabbiners kannst du auch als Podcast hören – in der „Substack“-App oder überall, wo es Podcasts gibt – unter dem Titel „Wort zum Schabbat“.
Freitags um 14 Uhr kannst du live dabei sein, wenn ein Rabbiner oder Lehrer seine Beobachtungen zum Wochenabschnitt der Tora weitergibt. So nimmst du teil:
Über die Website ahavta.clickmeeting.com.
Nur bei einer mobile Anwendung brauchst du die Event-ID: 922-427-295