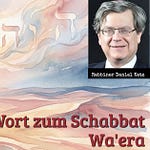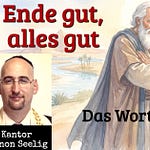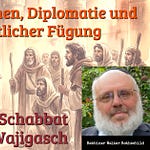Rabbiner Jehoschua Ahrens deutet Ki Teze in 5. Mose 21,10–25,19 als dichten Katalog von Sozial- und Charaktergesetzen, der Handeln, Verantwortung und zwischenmenschliche Ethik in den Mittelpunkt stellt, und verankert dies in Talmud, Rambam, Ramban und Hillel als Leitfaden für Elul und den Weg zu Rosch Haschana.
Einordnung der Parascha: Ki Teze umfasst die größte Sammlung einzelner Gebote der Tora; je nach Zählung sind es 74 (Sefer HaChinuch) oder 72, und sie reichen von Kriegsregeln über Familien-, Eigentums- und Arbeitsrecht bis zu Tierwohl und faires Wirtschaftsverhalten. Diese Vielfalt dient als „Mini‑Tora“ für eine gerechte Gesellschaft und rahmt den Abschnitt zwischen „Wenn du in den Krieg ziehst“ und dem Erinnerungsgebot an Amalek am Ende.
Bei ahavta - Begegnungen kannst du den Tora-Abschnitt der Woche in der Übersetzung durch Rabbiner Simon Bernfeld lesen oder sogar als Podcast anhören:
Warum Gebote? Ahrens greift die talmudische Maxime auf: „Größer ist, wer zum Gebot verpflichtet ist und es erfüllt, als wer nicht verpflichtet ist und es erfüllt“, und verweist auf Tosafot: Verpflichtung erzeugt inneren Widerstand, Sorge und ständigen Kampf mit den eigenen Neigungen; gerade das steigert den Wert der Tat und formt den Charakter. Freiwilligkeit ist gut, aber die Bindung an eine höhere Autorität zwingt zur Verantwortung.
Objektive Norm statt Subjektivität: Die Tora‑Mitzwot seien nicht beliebige Regeln, sondern Anspruch einer höheren Quelle; wie die Schöpfungsordnung die Natur trägt, ordnen die Gebote die moralische Welt und zielen darauf, das Gemeinwohl zu schützen und den Menschen von Willkür zu befreien. Daraus leitet Ahrens ab, dass Mitzwot nicht „legalistisch“ sind, sondern eine sittliche Schulung zum Guten.
Körper und Seele: In der Tradition wird die Zahl der positiven Gebote mit den „Gliedern“ des Menschen verglichen, um die Ganzheitlichkeit des Handelns zu betonen; das Einhalten von Geboten und das Meiden von Verboten bringt Heiligkeit in das Leben und verbindet leibliche Praxis mit seelischer Ausrichtung. Ziel ist eine integrierte Persönlichkeit, die sich an Gott ausrichtet.
Ethos des Handelns: Rambam betont, dass die Mitzwot negative Eigenschaften brechen und den Charakter bessern sollen; Ki Teze illustriert das in Sozialnormen wie Rückgabe verlorenen Eigentums, pünktlicher Lohnzahlung, Vorsorge durch Dachgeländer und Achtsamkeit gegenüber Schwachen und Tieren. Judentum ist damit wesentlich Praxis – Lernen geht in Tun über.
Elul und Teshuwa: Im Monat Elul bereitet man sich durch Selbstprüfung, Bitten um Vergebung und Versöhnung mit Mitmenschen auf Rosch Haschana vor; die hier geforderte Arbeit an sich selbst verbindet Frömmigkeit mit sozialer Verpflichtung. Der Schwerpunkt liegt auf zwischenmenschlichen Geboten, ohne die göttliche Beziehung zu vernachlässigen.
Hillels Kernformel: Auf die Frage nach der Tora „auf einem Bein“ lautet die Leitregel: „Was dir verhasst ist, tue deinem Nächsten nicht; der Rest ist Kommentar – geh und lerne.“ Ahrens liest dies als praktische Kompassnadel: Alle Gebote – vom Schabbat bis zur Wohltätigkeit – dienen der Rückbindung an den Anderen und der Einübung von Demut statt Ego‑Zentrierung.
Nutzen für den Menschen: In nachmanidischer Perspektive liegt der „Nutzen“ der Gebote beim Menschen selbst – zur Abwehr schädlicher Tendenzen, zur Erinnerung an Gottes Zeichen und zur Gotteserkenntnis; Gehorsam erschließt innere Ruhe und Frieden, weil er das Ich dezentriert und auf den Schöpfer verweist. So wird der ethisch‑moralische Imperativ der Tora durch konkretes Handeln zur Heiligung des Alltags.