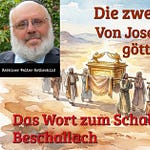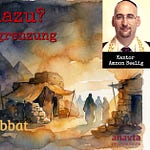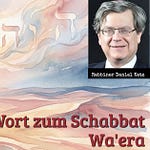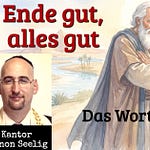Rabbiner Dr. Daniel Katz erläutert zum Wochenabschnitt Mattot-Massej, dass an diesem Schabbat das vierte Buch Mose, Bamidbar (Numeri), im jüdischen Jahreszyklus abgeschlossen wird. Der Abschnitt markiert den Übergang vom Monat Tammus zum schwierigen Monat Aw im jüdischen Kalender und steht zeitlich in der Periode der „drei Wochen“, die zwischen dem 17. Tammus und dem 9. Aw (Tischa beAw) liegt. In dieser Zeit wird des Falls und der Zerstörung Jerusalems gedacht.
Bei ahavta - Begegnungen kannst du den Tora-Abschnitt der Woche in der Übersetzung durch Rabbiner Simon Bernfeld lesen oder sogar als Podcast anhören:
Die Bedeutung der Gelübde
Im Zentrum der Parascha Mattot steht das Thema der Gelübde (Nedarim). Das Buch beginnt mit der Weisung: Wenn jemand dem Ewigen ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, darf er sein Wort nicht brechen. Alles, was über seine Lippen kommt, soll er einhalten. Rabbiner Katz betont die Ernsthaftigkeit, mit dem Namen Gottes verbundenen Versprechen zu begegnen – eine Regel, die nicht nur im Kontext der Zehn Gebote zentral ist („Du sollst den Namen des Ewigen, deines Gottes, nicht missbrauchen“), sondern auch den gesamten zwischenmenschlichen und den Menschen-Gott-Bereich betrifft.
Er hebt hervor, dass das Judentum traditionell rät, mit „bli neder“ („ohne Gelübde“) eine gewisse Zurückhaltung zu zeigen, da der Mensch nie sicher sein kann, künftige Zusagen immer einhalten zu können. Die jüdische Tradition betont daher Vorsicht vor vorschnellen Schwüren und das Bewusstsein um die Begrenztheit menschlicher Voraussicht.
Verknüpfung zu Kol Nidre und Jom Kippur
Katz zieht eine inhaltliche Linie von den Worten der Parascha zur Kol-Nidre-Liturgie am Beginn des Jom Kippur. Dort werden Gelübde gegenüber Gott, die nicht eingehalten wurden, zeremoniell annulliert. Dies betrifft jedoch nur das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, nicht zwischenmenschliche Verpflichtungen – diese müssen gegenüber dem Mitmenschen selbst bereinigt werden. Katz erklärt, dass die Formulierung und symbolische Kraft von Kol Nidre eine Reform darstellt, die sich im frühen Mittelalter entwickelte und heute als zentraler Moment des Jom Kippur gilt.
Zeitlicher Rahmen und historische Bezüge
Die Wochenabschnitte liegen kalendarisch vor der Zeit der historischen Katastrophen um Jerusalem, sowohl zur Zeit der Babylonier als auch der Römer. Katz spricht von der „Zerstörung Jerusalems“ als prägendes Trauma, das die dreiwöchige Trauerperiode und den Fastentag Tischa beAw bestimmt. Die Lesung von Mattot-Massej bildet dabei einen Übergang zwischen Trauer und der Hoffnung auf eine heilsame Zukunft, die im Monatsrhythmus und im Jahreszyklus des Judentums seinen Ausdruck findet.
Liturgische Entwicklungen
Abschließend weist Katz darauf hin, wie liturgische Reformen – etwa Kol Nidre oder Kabbalat Schabbat – zu essenziellen Elementen des jüdischen Gottesdienstes wurden. Sie zeigen die Lebendigkeit und Entwicklungsfähigkeit des religiösen Lebens im Dialog zwischen Tradition und Reform.