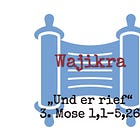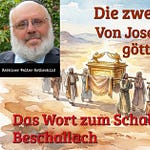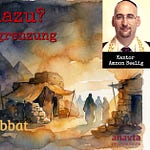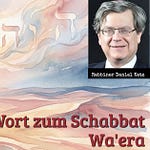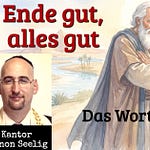Kantor Amnon Seelig erläutert den Wochenabschnitt Wajikra (3. Mose 1,1–5,26), der das dritte Buch Mose eröffnet. Es beginnt mit dem Wort [HaSchem, der HERR] rief [Mose].
Bei ahavta - Begegnungen kannst du den Tora-Abschnitt in der Übersetzung durch Rabbiner Simon Bernfeld lesen oder sogar als Podcast anhören:
Erstmals in der Tora begegnet im Wochenabschnitt der Begriff „Korban“, der mit „Opfer“ übersetzt wird. Eigentlich bedeutet die Wurzel des Wortes jedoch „sich nähern“. Im Gegensatz zu den in der Parascha befohlenen Opfern wie „Aufstiegsopfer“ oder „Darbringsopfer“ fehlt aber in den hebräischen Worten der Begriff „Opfer“.
Ein Korban ist demnach ein Akt, der den Menschen Gott näherbringt. Amnon betont, dass Juden heute keine Tieropfer mehr darbringen, da der Tempel fehlt. Stattdessen ersetzt das Gebet die Opfer, wie es seit 2000 Jahren Tradition ist. Er verwies auf Propheten wie Jeremia, die mechanistische Opfer kritisierten, wenn sie ohne innere Hingabe dargebracht wurden. Diese sprachen dann aber nie von „Korban“, sondern verwendeten die Namen der Opferarten, um die Heuchelei des Volkes anzuprangern. Ein echtes Korban hingegen, mit der Absicht, Gott nahe zu kommen, sei wohlgefällig.
Der Fokus von Amnons Ausführungen lag freilich auf dem ersten Wort der Parascha, Wajikra („Und er rief“), das den Anruf Gottes an Mose beschreibt. In der Torarolle wird das abschließende Aleph dieses Wortes auffällig klein geschrieben – eine von etwa 20 typografischen Besonderheiten in der Tora. Amnon erläuterte die gängigste Interpretation: Mose, bekannt für seine Bescheidenheit, habe es vermieden, Großes über sich zu schreiben. Obwohl er die Tora unter göttlichem Diktat verfasste, war es ihm unangenehm, dass Gott ihn persönlich rief – ein seltener und bedeutungsvoller Akt. Ohne das Aleph würde „Wajikra“ zu „Wajikar“ („Und er begegnete zufällig“) werden, was die Begegnung mit Gott abgeschwächt hätte. Mose schrieb das Aleph dennoch, aber klein, um seine Bescheidenheit zu wahren. Andere Auslegungen sehen darin Moses Zurückhaltung, die Führungsrolle zu übernehmen, die ihm Gott auftrug.
Amnon führte weiter aus, dass „Wajikra“ mit der Gematria (numerische Werte hebräischer Buchstaben) den Wert 317 ergibt (Waw=6, Jud=10, Kuf=100, Resch=200, Aleph=1). Dieser Wert entspricht exakt „Awraham Awinu“ (Abraham, unser Vater), was einen Kreis zu Abraham schließt. Abraham war der Erste, der Gott mit Namen anrief („Wajikra Beshem Adonai“), während Gott nun Mose ruft, um die Gesetze zu übergeben. Abraham begründete den Monotheismus, Mose formte das jüdische Volk zur Religion. Die Opfer und Gebote in Wajikra ermöglichen es, diesen Dialog mit Gott fortzusetzen.
Zusammenfassend betonte Amnon, dass Wajikra nicht nur von Opfern handelt, sondern von Nähe zu Gott – sei es durch Korban, Gebet oder Moses bescheidenen Dienst. Der Wochenabschnitt eröffnet einen Dialog, der mit Abraham begann und durch Mose vertieft wurde, und zeigt, wie Rituale und Demut den Menschen Gott näherbringen.
Die Tora-Auslegung des Rabbiners kannst du auch als Podcast hören – in der „Substack“-App oder überall, wo es Podcasts gibt – unter dem Titel „Wort zum Schabbat“.
Freitags um 14 Uhr kannst du live dabei sein, wenn ein Rabbiner oder Lehrer seine Beobachtungen zum Wochenabschnitt der Tora weitergibt. So nimmst du teil:
Über die Website ahavta.clickmeeting.com.
Nur bei einer mobile Anwendung brauchst du die Event-ID: 922-427-295