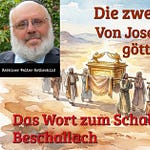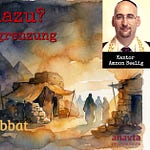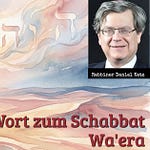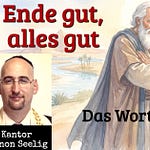Rabbiner Andrew Steiman zum Wochenabschnitt Zaw (3. Mose 6–8), die Vorbereitungen auf Pessach und die tiefere Bedeutung des Festes. Unser Gespräch, geprägt von Humor, Reflexion und interreligiösem Austausch, drehte sich um Themen wie Stress, Dankbarkeit, Freiheit und die Bewältigung von Leid.
Bei ahavta - Begegnungen kannst du den Tora-Abschnitt der Woche in der Übersetzung durch Rabbiner Simon Bernfeld lesen oder sogar als Podcast anhören:
Der Wochenabschnitt Zaw beschreibt verschiedene Opfer, darunter das Dankopfer, das laut Rabbiner Steiman heute in Form des Gebets „Birkat HaGomel“ weiterlebt. Dieses wird gesprochen, wenn jemand eine gefährliche Situation überstanden hat, wie etwa die Befreiung aus Gefangenschaft – ein Thema, das angesichts aktueller Ereignisse besondere Relevanz erhält. Der Psalm 107 nennt vier solche Situationen: Überquerung des Meeres, Durchquerung der Wüste, Genesung von Krankheit und Befreiung aus Gefangenschaft.
Pessach stand im Zentrum des Gesprächs, da der Schabbat zugleich Erew Pessach ist, was selten vorkommt und die Vorbereitungen leicht hektisch werden lässt. Rabbiner Steiman schildert humorvoll den Stress der Chamez-Beseitigung, etwa das symbolische Verbrennen von Gesäuertem und den „Verkauf“ an Nichtjuden. Diese Rituale, so betont er, sind nicht nur Arbeit, sondern auch Ausdruck von Gemeinschaft und Erinnerung. Pessach fordert dazu auf, sich selbst als aus Ägypten befreit zu fühlen, um die Erfahrung von Unterdrückung und Freiheit lebendig zu halten.
Ein zentraler Punkt ist die Verbindung von Leid und Hoffnung. Pessach erinnert an die Unterdrückung in Ägypten, symbolisiert durch Bitterkraut, aber auch an die Befreiung, dargestellt durch Mazzen – das „Brot der Armut“ und zugleich der Freiheit. Diese Dualität findet sich auch im christlichen Ostern, wo das Leiden Jesu mit der Hoffnung auf Auferstehung verknüpft ist. Der Rabbiner erzählt von Gesprächen mit seinem atheistischen Bruder, der die Freiheit hinterfragt, was Parallelen zu frühen christlichen Juden aufzeigte, die Hoffnung aus Leid schöpften.
Aktuelle Herausforderungen, wie der Krieg in Israel seit dem 7. Oktober, fliessen in die Diskussion ein. Neue Haggadot und Gebete für Geiseln spiegeln die Resilienz wider, während Rituale wie das Anzünden einer Kerze mit gelber Schleife Solidarität ausdrücken. Kunst, Humor und gemeinsames Singen, etwa „Wehi Sche’amda“, helfen, Ängste zu bewältigen. Steiman kritisierte jedoch die Vereinnahmung jüdischer Identität durch Konvertiten wie Homolka, die den Dialog vereinfachen, anstatt authentische Begegnung zu fördern.
Dankbarkeit durchzog das Gespräch als Schlüssel zur Lebensbewältigung. Leo Baeck wurde zitiert: Dankbarkeit macht das Leben leichter. Die 14 Stationen des Seder, beginnend mit Kadesh, strukturieren diesen Prozess – von der Erinnerung an Leid bis zur Hoffnung auf Freiheit, symbolisiert durch „Nächstes Jahr in Jerusalem“. Der interreligiöse Austausch zeigt Gemeinsamkeiten: Christen leiden mit Jesus und hoffen auf Auferstehung, Juden erinnern an Ägypten und feiern Freiheit.
Das Gespräch endet mit einem Plädoyer für Bescheidenheit, gegenseitige Wertschätzung und das Überwinden alter Denkmuster – ein „gesellschaftliches Pessach“, um das „Gesäuerte“ in der Welt zu beseitigen. Rabbiner Steiman wünscht uns ein koscheres, fröhliches Pessach und frohe Ostern, da beide Feste in diesem Jahr zeitlich nahe beieinander liegen, und betont die universelle Botschaft von Freiheit und Hoffnung.
Die Tora-Auslegung des Rabbiners kannst du auch als Podcast hören – in der „Substack“-App oder überall, wo es Podcasts gibt – unter dem Titel „Wort zum Schabbat“.
Freitags um 14 Uhr kannst du live dabei sein, wenn ein Rabbiner oder Lehrer seine Beobachtungen zum Wochenabschnitt der Tora weitergibt. So nimmst du teil:
Über die Website ahavta.clickmeeting.com.
Nur bei einer mobile Anwendung brauchst du die Event-ID: 922-427-295